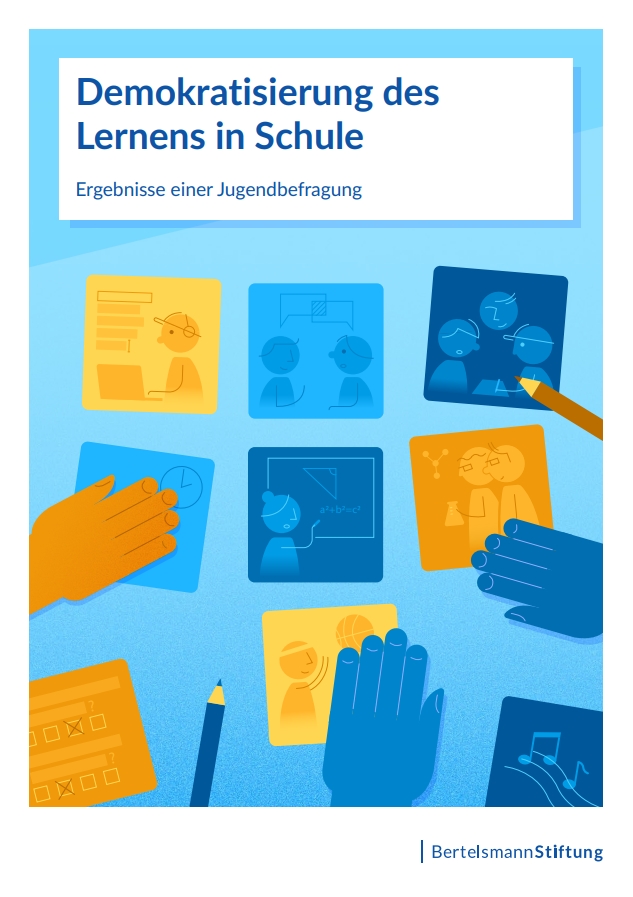Die Jugendbefragung wurde vom Meinungsforschungsinstitut iconkids & youth international research GmbH im Zeitraum vom 08.11. – 01.12.2024 durchgeführt. Die Online-Interviews erfolgten mit einem strukturierten Fragebogen und dauerten in der Regel 15 Minuten. Es haben 1044 Schüler:innen im Alter zwischen 12 und 16 Jahren teilgenommen. Sie liefert detaillierte Ergebnisse dazu, in welchem Maße Schüler:innen der Sekundarstufe I Mitbestimmung in ihrem Unterricht erleben.
Einige der wichtigsten Erkenntnisse der Studie im Überblick:
- Die deutliche Mehrheit der Schüler:innen erlebt eine diskussionsförderliche Unterrichtskultur: 44 Prozent
werden oft und 39 Prozent manchmal von ihren Lehrkräften ermutigt, sich selbst eine Meinung zu bilden. Das heißt allerdings auch, dass 17 Prozent dies selten oder nie erleben. Und ebenso viele Schüler:innen sagen, dass sie selten oder nie frei und offen ihre Meinung äußern können.
- Es besteht durchaus größere Offenheit für andere Meinungen und kontroverse Diskussionen im Unterricht: Die Mehrheit der Schüler:innen erlebt im Unterricht Offenheit auch für Meinungen, die dem Mainstream nicht entsprechen. Das stellt das rechtspopulistische Narrativ infrage, man dürfe seine Meinung nicht sagen. Gleichzeitig zeigt sich, dass der Umgang mit Kontroversität im Unterricht erlernt werden kann.
- Mitbestimmung im Unterricht ist eher selten möglich: Bei der Beteiligung an der Unterrichtsgestaltung ist deutlich Luft nach oben: Besonders selten sehen sich Schüler:innen einbezogen, wenn es darum geht, Themen und Inhalte für den Unterricht auszuwählen. Partizipation beschränkt sich meist auf organisatorische Aspekte – etwa auf die Wahl des Sitz- bzw. Arbeitspartners und auf Klassenregeln.
Die Auswertung der Studie zeigt: In der Beteiligung steckt ein großes Potenzial für die Gestaltung wirksamer Lernprozesse, das sich bislang aber nur selten entfaltet. Nur wenn sich Schüler:innen zur Mitgestaltung des Unterrichts und ihres Lernprozesses ermutigt fühlen, entwickeln sie Zutrauen und erleben Selbstwirksamkeit sowie Zugehörigkeit. Wichtig dabei ist allerdings, dass ihre Stärken, Interessen und individuellen Bedarfe berücksichtigt werden. Derart gestaltete Partizipationsprozesse haben auch einen positiven Effekt auf die Lernbereitschaft und das schulische Wohlbefinden.